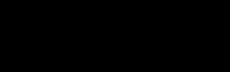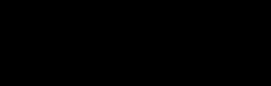Lichtblicke – made in AfricaDürre, Elend, Armut, Seuchen: Das Afrikabild des gewöhnlichen Mitteleuropäers ist noch immer düster. Dabei entstehen überall auf dem Kontinent Projekte, die viel über die Kreativität und Leistungsfähigkeit seiner Menschen verraten.
Von Wolfgang Drechsler/RND
Wenn sogar Mark Zuckerberg
beeindruckt ist, dann muss doch was dran sein. Fast schwärmerisch hat
der Facebook-Gründer die unternehmerische Energie besungen, die er bei
seiner Afrikareise verspürt hat: „Wenn die Welt diese Leidenschaft
eines Tages entdeckt, wird Afrika die Welt verändern.“
Bis zur afrikanischen
Weltrevolution könnte es jedoch schon deshalb noch etwas dauern, weil
der Besuch des selbst ernannten Weltverbesserers aus Kalifornien im
September vergangenen Jahres von einem herben Rückschlag überschattet
wurde:
Im US-Raumfahrtzentrum Cape Canaveral explodierte Facebooks erster
Satellit. Dieser Zuckerberg-Satellit sollte entlegene Regionen Afrikas
mit freiem Internet versorgen – und dort vor allem Kleinunternehmern
Anschub auf dem Weg in die Selbstständigkeit geben.
Jetzt backt der
Selfmade-Milliardär erst einmal kleinere Brötchen und treibt ein
Drohnenprojekt voran. Dies soll nicht nur schnelles Internet, sondern
auch andere Dienstleistungen offerieren. Nur: Zuckerberg ist längst
nicht der Einzige,
der das Potenzial des Schwarzen Kontinents entdeckt hat.
Ganze Entwicklungsstufen lassen sich überspringen
Die Konkurrenz kommt aus
dem heimischen Silicon Valley, Zipline zum Beispiel. Das mit viel
Risikokapital ausgestattete Start-up will mit kleinen, unbemannten
Lieferdrohnen medizinische Ausrüstung in schwer zugängliche Regionen
fliegen.
Das deutsche Start-up Mobisol will Drohnen nutzen, um Ersatzteile für
Solaranlagen in entlegene Teile Tansanias und Ruandas zu schaffen.
Fortschritt durch
Digitalisierung, Überflieger statt Straßen: Visionäre glauben, dass
Afrika eine einzigartige Chance hat. Der Kontinent könne, so heißt es,
ganze Entwicklungsstufen auslassen, Technologien einfach überspringen.
Investoren
und Gründer lassen sich mitreißen von einem Optimismus, der sich aus
schier unerschöpflichem Erfindungsreichtum speist. Pessimisten glauben
eher, dass es die Not ist, die erfinderisch macht. Sie zweifeln daran,
dass Mobiltelefone, Solarmodule und Drohnen das
Fehlen von Banken, Kraftwerken oder Straßen tatsächlich kompensieren
können. Sie verweisen darauf, dass Hunger, Gewalt und Korruption nach
wie vor allgegenwärtig sind. Das stimmt. Aber es stimmt eben auch, dass
an allen Ecken und Enden Lichtblicke aufblitzen.
Und es sind nicht nur
mutige Entrepreneurs, die nicht länger auf helfende Hände warten und
einfach loslegen. Sondern es sind auch ganze Staaten. Der
beeindruckendste unter ihnen: Ruanda.
„Vision 2020“: Ruanda
„Ich habe mich oft gefragt,
warum der Westen mehr Interesse hat, uns Hilfe zu schicken, statt
fairen Handel mit uns zu treiben“, sagt Präsident Paul Kagame. „Der
freie Austausch von Waren würde viel mehr Geld in den Händen der
Menschen
lassen als jede Hilfe.“
Kagame, der in diesem Jahr
dank einer Verfassungsänderung zum dritten Mal als
Präsidentschaftskandidat antritt, gilt den Ruandern als „aufgeklärter
Despot“. Er regiert mit harter Hand. Aber selbst Kritiker gestehen ihm
zu, dass Ruanda,
vor 20 Jahren zerstört vom grausamsten Völkermord seit dem Holocaust,
eine in Afrika einzigartige Metamorphose vollzogen hat.
Unerbittlich verfolgt der
einstige Rebellenführer seine „Vision 2020“: In den nächsten drei Jahren
soll der Zwergstaat im Herzen Afrikas den Sprung vom Agrar- zum
Hightech-Land geschafft haben. In der Hauptstadt Kigali werden dazu
heute
überall neue Funkmasten errichtet und Glasfaserkabel verlegt, freies
Internet gibt’s in jedem größeren Café. Noch der letzte Winkel des
Landes soll mit dem Rest der Welt verbunden werden. Nahe Kigali hat
Kagame eine Sonderwirtschaftszone eingerichtet und innerhalb
eines Jahres ausländische Direktinvestitionen um 78 Prozent erhöht.
Spitzenreiter bei den Investoren: Mauritius, die Schweiz, die USA und
Luxemburg. Innovationsfreudige Ruander selbst können heute innerhalb von
48 Stunden ein Geschäft anmelden, online – ohne
Schmiergeld für eine korrupte Bürokratie.
Belohnt für vorausschauende Politik
In vieler Hinsicht ist
Ruanda mit seinen 12 Millionen Menschen Vorreiter des Kontinents:
Während fast überall in Afrika die Urwälder abgeholzt werden, ist der
Anteil der Waldfläche in Ruanda seit 1994 um mehr als ein Drittel
gestiegen.
Das beschert Touristen, die Gorillas sehen wollen, und schützt vor
allem vor Erosion und Überweidung. Das mit Abstand am dichtesten
besiedelte Land des Kontinents kann sich dank dieser vorausschauenden
Politik heute selbst ernähren.
Paul Kagame bewundert die
asiatischen Tigerstaaten Südkorea und Singapur – „für ihre Entwicklung
und dafür, dass sie intensiv in ihre Menschen und in Technologie
investiert haben“. Praktisch alle ruandischen Kinder gehen heute zur
Schule.
Und der Weltbank gilt Ruanda heute als Staat mit dem
investorfreundlichsten Klima Afrikas.
Mit der Sonne zum Licht
Es muss nicht immer Hightech sein
Silicon Savannah, Labor für einen Kontinent
Mobile Welt, mobiles Geld
Schokolade zum nicht Dahinschmelzen
Die schlaueste App-Idee 2017
Wo die Drohne Rettung bringt
Das Kerngeschäft der Zukunft
Ushahidi informiert in größter Not
Kenia: Silicon Savannah, Labor für einen Kontinent
Sie sind jung, clever, afrikanisch – und reich. Sie haben sich ihren
Reichtum selbst erarbeitet. „Generation Cheetah“, Generation Gepard,
nennen sie sich selbst. Schnell und immer auf der Hut. Leute wie Dennis
Makori gehören dazu: Grundschule unter einem
Baum in Westen Kenias, zum ersten Mal elektrisches Licht angeknipst mit
13, den ersten Computer gesehen im Elektronikstudium – und nie wieder
zurückgeschaut. „An diesem Computer entdeckte ich, dass ich ein
verborgenes Talent hatte, Probleme durch Programmieren
zu lösen“, sagt der 37-Jährige. Makori gründete 2010 Onfon Media, einen
IT-Dienstleister, der heute in fünf afrikanischen Ländern mehr als zehn
Millionen Kunden hat. Makori selbst ist mit einem Jahresumsatz von rund
5 Milliarden Euro Multimillionär und Arbeitgeber
für rund 3000 Menschen, fährt BMW, trinkt französischen Rotwein und hat
seine Wurzeln nie vergessen: „Ich war arm, also habe ich hart
gearbeitet.“
Es gibt einen Ort in Afrika, der ist voll von solchen Menschen: der
iHub im Herzen der kenianischen Hauptstadt Nairobi. In der Ngong Road
entstand 2010 in einem alten Einkaufszentrum die Keimzelle der digitalen
Revolution Afrikas. Ein Innovationszentrum
ist daraus geworden, Hunderte Start-ups sind hier gegründet worden. Sie
alle erfinden gegen den Mangel an. Gegen den Mangel an Infrastruktur,
an Fachkräften, an staatlicher Organisation. Das Bezahlsystem M-Pesa,
das Überweisungen per Handy ermöglicht, wurde
hier geboren, iCow, eine App, die Viehzüchter über Marktpreise und
drohende Seuchen informiert, Lernapps für Kinder, ein mobiler Router mit
eingebauter SIM-Karte und Akku, der einen Stromausfall übersteht –
kurz, afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme.
Seit Februar residieren die Nerds in schickeren, größeren Räumen. Sie
können es sich leisten. In Kenia trägt der IT-Sektor schon jetzt mehr
als 5 Prozent zur Wirtschaftsleistung bei. Weltkonzerne wie Google,
Microsoft und Facebook haben sich rund um den
Hub angesiedelt. Der nennt sich in Anspielung auf das kalifornische
Vorbild nun stolz Silicon Savannah.
Äthiopien: Mit der Sonne zum Licht
Der Ziegenhirte im äthiopischen Hochland trägt einen Rucksack, der
von oben bis unten mit Solarpaneelen besetzt ist. Wenig später laufen
Schulkinder vorbei – auch sie mit Solarrucksäcken. Mit jedem Schritt
erzeugen der Hirte und die Kinder Energie.
„Soular“ ist die Erfindung der 24-jährigen Südafrikanerin Salima
Visram. Die Sonnenenergie, die die Kinder auf ihrem oft stundenlangen
Schulweg über die Paneele sammeln, spendet ihnen abends Licht zum
Lernen. Ganz einfach. Und genial.
Alle reden von der digitalen Revolution – aber viele vergessen, dass
jedes Handy, jeder Router, jeder Computer nichts ist ohne Strom. Und den
haben die wenigsten in Afrika. 620 Millionen Menschen, die Hälfte der
Afrikaner, gelten als „energiearm“. Das ostafrikanische
Äthiopien setzt jetzt mit einer Doppelstrategie dagegen: mit dem
langfristigen Ausbau einer Energiewirtschaft, die die rasante
Industrialisierung des Landes ausschließlich mit erneuerbaren Energien
absichern soll und mit einer Zwischenlösung, die Licht in
jede Hütte bringt. Damit macht Äthiopien genau das, was der einstige
UN-Generalsekretär Kofi Annan jüngst in einem Expertenbericht gefordert
hat: Der erste Schritt zur Elektrifizierung Afrikas ist der Zugang zu
Solaranlagen. Und zwar unabhängig von großen
Verteilernetzen, deren Aufbau Jahrzehnte braucht.
Äthiopien hat die deutsche Stiftung Solarenergie – halb gemeinnützig,
halb privatwirtschaftlich – dafür ins Boot geholt. Im Dorf Rema hat
diese ihr bislang größtes Solarprojekt aufgebaut und damit das
Wirtschaftsleben in der ganzen Region spürbar angekurbelt.
Auch zehn Gesundheitsstationen haben Solaranlagen für Licht und
Medikamentenkühlung erhalten. Wo in den Hütten gerade noch Kerosinlampen
flackerten, strahlt heute das bläuliche Licht der LED-Leuchten. Auch
das ein Wirtschaftsfaktor: 72 Dollar im Jahr gibt
eine Familie bislang für Kerzen oder Kerosin aus – bei einem
Jahreseinkommen von 550 Dollar. Eine Solarlampe kostet weniger als
5 Dollar. Und die Kinder liefern die Energie frei Haus.
Mauritius: Mobile Welt, mobiles Geld
Nirgendwo auf der Welt ist es leichter, eine Rechnung zu bezahlen, als
in Afrika. Ohne Bargeld, Kreditkarte, Cashkarte – einfach mit dem
Telefon. Es muss nicht einmal ein cleveres Smartphone sein, die simple
Variante mit Prepaid-Karte genügt. Die mobile
Geldbörse ist alles, was ein ganzer Kontinent braucht, um seine
Finanzgeschäfte zu erledigen. In Subsahara-Afrika (ohne Südafrika) sind
nur 30 Millionen Kontokarten im Einsatz – aber 150 Millionen mobile
Geldbörsen, mit einem geschätzten Inhalt von 90 Milliarden
Dollar. Als „Banken“ für Ein- und Auszahlungen fungieren Tankstellen,
Kioske, Handyläden.
Die Idee ist nicht originär afrikanisch – ein erstes mobiles
Überweisungssystem gab es 2001 auf den Philippinen –, aber niemand hat
es so zur Perfektion gebracht wie afrikanische Unternehmer. Und niemand
hat die simple Idee, Menschen ohne eigenes Bankkonto
den Transfer und Empfang von Geld zu ermöglichen, derart global
weitergedacht wie Dare Okoudjou aus dem Benin. Vor sechs Jahren hat er
auf der Insel Mauritius die Plattform MFS Africa für mobile
Finanztransaktionen gegründet, die regionale und lokale Anbieter
verknüpft – und damit den Weltmarkt für rund 60 Millionen Menschen in
17 afrikanischen Ländern öffnet. Das hat Auswirkungen bis nach
Deutschland. Mit einer SMS und einer PIN können Okoudjous Kunden Geld
mit Menschen außerhalb ihres eigenen Landes und eigenen
Netzwerkes wie M-Pesa oder Tigo Cash austauschen. Menschen, die in die
Stadt gezogen sind, unterstützen auf diese Weise ihre Familien auf dem
Land. Sie beziehen ihren Lohn, bezahlen ihre Miete, sparen, nehmen einen
Kredit auf – in Ländern, in denen mangels
Banken nicht einmal ein Drittel der Bevölkerung ein Girokonto hat.
Und: Hunderte Milliarden Euro werden jedes Jahr von Migranten in ihre
Heimatländer überwiesen. Die privaten Geldtransfers spielen eine riesige
Rolle bei der Armutsbekämpfung, sie sind heute dreimal so hoch wie die
offizielle Entwicklungshilfe aller Mitgliedsländer
der OECD zusammen. Dank Leuten wie Okoudjou kommen sie garantiert an.
Ghana: Das Kerngeschäft der Zukunft
Die Welt hungert – nach Cashewkernen. Um rund 10 Prozent steigt der
weltweite Konsum jährlich. Im Westen Afrikas setzen Hunderttausende
Bauern auf bescheidenen Wohlstand dank des Cashew-Booms. Eine, die schon
heute vom Geschäft mit den nussigen Kernen profitiert,
ist Victoria Ataa aus dem ghanaischen Dorf Congo: „Diese Bäume haben
mein Leben verändert. Sie haben mich zu einer glücklichen Frau gemacht.“
Vor Jahren entdeckte Ataa, dass selbst Dürrezeiten den ausladenden
Bäumen kaum etwas anhaben. Dass die in Afrika nicht
allzu beliebten Kerne in Europa oder Asien begehrte Ware sind, wusste
die Frau da noch nicht. Erst der Vorsitzende der Vereinigung der
Cashew-Bauern gab den entscheidenden Tipp. Vor 14 Jahren gehörte Ataa,
die bis dahin in Plastikbeutel abgefülltes Wasser
am Straßenrand verkauft hatte, zu den Pionierinnen eines neuen
Industriezweigs. Die meisten Bauern hatten da noch keine Ahnung, an wen
sie ihre Ernte zu welchem Preis verkaufen konnten.
Um das buchstäblich
auf den Feldern vergammelnde Potenzial zu nutzen,
wurde 2009 die Competitive Cashew Initiative ins Leben gerufen, die
Bauern berät, wie sie durch bessere Anbau-, Ernte- und Lagermethoden
ihre Erträge steigern können. 400 000 Landwirte hat die Initiative auch
mit deutscher Hilfe und der Bill & Melinda Gates
Foundation in Westafrika bereits gefördert – unter ihnen Victoria Ataa.
„Früher habe ich fünf bis acht Säcke geerntet, in diesem Jahr waren es
16“, berichtet die 66-Jährige stolz. 600 000 Tonnen Cashewkerne
exportiert Ghana heute, die Kleinbauern erwirtschaften
damit einen erheblichen Teil des Bruttosozialprodukts. Aus
erfolgreichen lokalen Kooperativen ist ein Zukunftsprogramm geworden.
Arbeitslose Jugendliche drängt die Regierung jetzt, zurück aufs Land zu
gehen und Farmer zu werden. Victoria Ataa weiß, dass es
sich lohnt. Ihre Einnahmen haben sich in zehn Jahren verzehnfacht, sie
hat ein Haus gebaut, Kühe gekauft und ihren ältesten Sohn zum
Landwirtschaftsstudium nach Accra geschickt. Auch er mischt fleißig im
Cashew-Geschäft mit.
Ruanda: Wo die Drohne Rettung bringt
In den Industrieländern redet man noch – im kleinen Ruanda hat das
Zeitalter des kommerziellen Drohnenverkehrs bereits begonnen. Das hat
viel mit den geografischen Gegebenheiten im „Land der 1000 Hügel“ zu
tun, viel mit der katastrophal schlechten medizinischen
Versorgung der Menschen in Dörfern, zu denen keine Straßen führen – und
ganz viel damit, dass Präsident Paul Kagame kurz entschlossen verkündet
hat: Wir halten uns nicht lange mit Regularien auf, wir machen das.
„Das“ ist der Einsatz von Drohnen. In den Kriegsgebieten dieser Welt töten sie Menschen. In Ruanda sollen sie Leben retten.
Im Oktober hat die Regierung von Ruanda einen Vertrag mit dem
US-amerikanischen Start-up Zipline geschlossen. Dessen Drohnen fliegen
seither im Notfall Blutkonserven zu Verletzten oder blutenden
Schwangeren in die abgelegensten Dörfer, dorthin, wo solche
Patienten bislang kaum eine Überlebenschance hatten. Die GPS-gesteuerte
Drohne muss nicht landen: Sie lässt die Kühlbox mit dem Blutplasma an
einem kleinen Fallschirm niedersinken – und ein Mediziner aus dem
nächsten Gesundheitszentrum nimmt es in Empfang.
Die Drohe dreht gleich wieder um, 150 Kilometer schafft sie am Stück,
bei einer Geschwindigkeit von bis zu 130 Stundenkilometern. Was das
bedeutet, wissen nur Einheimische wie der Distriktsarzt Jeremy Murigande
aus dem bergigen Norden des Landes zu schätzen:
„Von unserer Klinik zur nächsten Blutbank sind es vier Stunden über
Schotterstraßen – bis wir Konserven geholt haben, ist der Patient tot.“
150 Lieferungen kann Zipline in dieser ersten Testphase täglich
übernehmen. Der nächste Schritt ist schon geplant. Demnächst sollen auch
andere lebenswichtige Medikamente angeflogen kommen – und Präsident
Kagame lässt den ersten Drohnenflughafen der Welt
bauen. Das Design stammt vom britischen Stararchitekten Norman Foster.
Dessen Stiftung plant übrigens Großes: Bis 2030 soll jedes Landstädtchen
in Afrika so einen Drohnen-Hafen haben – und alle Menschen sollen
sicher und schnell mit Medizin versorgt werden.
Nigeria: Die schlaueste App-Idee 2017
Wer hätte erwartet, dass die innovativste App des Jahres 2017 aus
Nigeria kommen würde? Zumindest nach Überzeugung der Jury des Global
Mobile World Awards, einer Art Oscar der Telekommunikationsbranche, der
jährlich auf dem Mobile World Congress in Barcelona
verliehen wird. Sliide Airtime heißt die Smartphone-Anwendung, die
eines der gravierendsten Fortschrittshemmnisse in Entwicklungs- und
Schwellenländern beheben will: unzureichenden Internetzugang für
Hunderte Millionen Menschen. Dabei ist die technische Infrastruktur
im Zeitalter weit ausgebauter Mobilfunknetze auch in vielen Regionen
Afrikas längst nicht mehr die entscheidende Hürde. Zumeist kommen die
Menschen schlicht nicht ins Netz, weil sie das Datenvolumen nicht
bezahlen können.
Die Alliance für Affordable Internet (A4AI), eine Unterorganisation
der „Internetregierung“ World Wide Web Foundation, legt in ihrem
jüngsten Erschwinglichkeitsbericht offen, dass das Internet noch längst
kein demokratisches Medium ist: „Über vier Milliarden
Menschen sind noch heute offline, die meisten von ihnen Frauen, die
meisten in den Entwicklungsländern und die meisten, weil sie es sich
nicht leisten können“, stellt der Bericht fest. Demnach kostet ein
Datenvolumen von nur einem Gigabyte einem Durchschnittsafrikaner
fast 18 Prozent seines monatlichen Einkommens.
An dieser Stelle greift die im März 2016 eingeführte Sliide-App, die,
um dem afrikanischen Markt Rechnung zu tragen, eigens für ältere und
leistungsschwächere Smartphones entwickelt wurde: Wer sie herunterlädt,
bekommt neben Nachrichten auch gesponserte
Inhalte auf den Sperrbildschirm seines Smartphones geschickt. Im
Gegenzug erhalten die Nutzer Gratisdaten. Durch die Teilnahme an
Umfragen und anderen Aufgaben lässt sich das Datenvolumen zusätzlich
erhöhen. Für die Werbetreibenden ist die App wiederum interessant,
weil sie hilft, Einsichten über den afrikanische Markt zu gewinnen.
Togo: Schokolade zum nicht Dahinschmelzen
Jetzt, in der wärmen Jahreszeit, schmilzt sie schnell dahin: Schokolade.
In Togo, wo man an heiße Temperaturen gewöhnt ist und gewaltige Mengen
des Schokoladenrohstoffs Kakao angebaut werden, hat eine kleine
Kooperative von Studenten und Kakaobauern eine
die Lösung gefunden: Eine Schokolade, die nicht so schnell die Form
verliert und selbst bei 35 Grad Celsius noch knackig fest sein soll.
Freilich ist der Genuss mit einem Kakaoanteil von 60 bis fast 100
Prozent (je nach Sorte) eher für Feinschmecker als für
Zuckerjunkies – dafür eignet sich die Schokolade der in Togos
Hauptstadt Lomé ansässigen Kooperative Choco Togo perfekt für Szenarien,
die ohne Kühlung auskommen müssen – etwa für Straßenmärkte. Dahinter
verbirgt sich mehr als eine süße Revolution.
Obwohl Afrika rund drei Viertel des globalen Kakaoanbaus bestreitet,
wurde auf dem Schwarzen Kontinent bislang keine Schokolade produziert –
obwohl das der mit Abstand lukrativste Teil der Wertschöpfungskette ist.
Der Kostenanteil des Rohkakaos an einer
Tafel Vollmilchschokolade beträgt je nach Exportland gerade einmal
zwischen 3 und 4 Cent. Da Kakao überwiegend von Kleinbauern mit wenigen
Hektar Land angebaut wird und die Erträge mangels kostspieliger
Düngemittel mager sind, kommen die Erzeuger kaum über
die Runden. Choco Togo ist der Versuch, ein größeres Stück von der
Tafel im Land zu behalten. 1500 Kleinbauern produzieren für die
Kooperative, 40 Frauen verarbeiten die Rohware in Handarbeit zu
Schokolade in Bioqualität – und das für Löhne, die eine echte
Lebensperspektive bieten.
Auf dem europäischen Markt hat sich die Schokolade der 2013 gegründeten
Manufaktur zwar noch nicht etabliert, aber dass die hitzebeständigen
Tafeln auch hierzulande ihre Fans gewinnen könnten, deutete sich jüngst
auf der Brüsseler Schokoladenmesse an. Binnen
eines Tages verkaufte Choco Togo die gesamte Charge – für faire 1,50
Euro pro 80-Gramm-Tafel.
Südafrika: Es muss nicht immer Hightech sein
Im richtigen Leben zählen praktische Lösungen oft mehr als hochkomplexe
Innovationen. Mit einem rollenden Fass haben die südafrikanischen
Ingenieure Pettie Petzer und Johan Jonker den Alltag von
Hunderttausenden Frauen und Kindern verändert. Petzer und Jonker
haben eigenem Bekunden nach nichts weiter getan, als „zwei und zwei
zusammenzuzählen – und herausgekommen ist der Hippo-Roller“.
Dies ist das Problem: 1,2 Millionen Afrikaner leben in Gegenden mit
extremer Wasserknappheit. Frauen verbringen bis zu ein Drittel ihrer
Lebenszeit mit Wasserholen, Kinder laufen jeden Tag mehrere Stunden bis
zur nächsten Quelle oder dem nächsten Brunnen,
um Wasser zum Trinken, Kochen, Waschen zu holen. Zeit, die die Kinder
weder zum Lernen noch zum Spielen und die Frauen weder für die
Gartenarbeit noch einen Nebenerwerb nutzen können. Für Touristen ist es
ein faszinierender Anblick, wenn die Frauen mit 20-Liter-Eimern
voll Wasser auf dem Kopf über die Savanne schreiten. Für die Frauen ist
es pure Qual.
Dies ist die Lösung: Petzer und Jonker haben ein verstärktes
Polyethylenfass mit einem versenkten Deckel und einem Stahlgestänge
versehen. 90 Liter Wasser kann eine Person darin auch über unwegsames
Gelände nach Hause rollen – genug Wasser für eine fünfköpfige
Familie für drei Tage. Ein Fass hält etwa fünf Jahre. Rund 50 000
Hippo-Rollers sind bisher gebaut worden. Für 125 Dollar werden sie von
Sponsoren gekauft und verteilt.
Zusatzbonus: Die Roller werden eng gepackt in Einzelteilen geliefert und
vor Ort von Dorfbewohnern zusammengebaut. Zu einem fairen Lohn.
Überall: Ushahidi informiert in größter Not
Viele Innovationen, die derzeit aus Afrika kommen, sind keine
technologischen Erfindungen. Sie verwenden vielmehr bestehende
Technologie und nutzen sie neu, um Lösungen für alltägliche Probleme zu
finden. Eine der nachhaltigsten ist der 2008 gegründete und
im kenianischen Silicon Savannah angesiedelte Mappingdienst Ushahidi.
Ushahidi heißt so viel wie Augenzeuge. Der IT-Experte Eric Hersman und
die kenianische Rechtsanwältin Ory Okolloh haben die App entwickelt:
Zeugen speisen Informationen zu Korruption und Seuchen, aber auch und
gerade zu gewaltsamen staatlichen Übergriffen
auf einer Google-Maps-Karte ein – etwa bei den Unruhen in Kenia nach
den Wahlen im Jahre 2008. Innerhalb weniger Stunden verwandelte sich
damals selbst das junge Silicon Savannah in ein Schlachtfeld. Mehr als
1500 Menschen starben in Kenia. Und die Welt wurde
in Echtzeit informiert.
Ushahidi stellt die kostenlose Software zur Verfügung, mit der
interaktive Katastrophenkarten erstellt werden. Opfer, Beobachter oder
Helfer verschicken per E-Mail oder SMS Lageberichte, die Software zeigt
diese als Ereignis auf einer Landkarte an. Die meisten
Sponsoren haben sich an Ushahidi beteiligt, weil sie die politischen
Aspekte des Projekts interessierten.
Heute gibt es im Internet rund 45 000 Karten, die auf Ushahidi fußen.
Die UN und internationale Rettungsdienste setzen die Software weltweit
ein. In Mazedonien nutzt sie etwa die Organisation Transparency Watch,
um Korruption zu protokollieren. Auch die
von dem Taifun „Haiyan“ auf den Philippinen angerichteten Schäden
konnten Wissenschaftler in einer Ushahidi-Karte akkurat zusammenführen –
und auf dieser Grundlage Vorsorgekonzepte entwickeln.
Headline
jkfdsjgdklöjklösdfklöhg jkfdsjgdklöjklösdfklöhg jkfdsjgdklöjklösdfklöhg jkfdsjgdklöjklösdfklöhg jkfdsjgdklöjklösdfklöhg jkfdsjgdklöjklösdfklöhg jkfdsjgdklöjklösdfklöhg jkfdsjgdklöjklösdfklöhg jkfdsjgdklöjklösdfklöhg